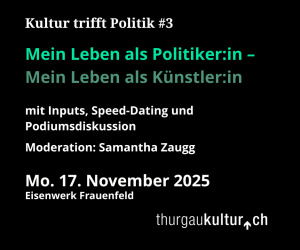von Urs Oskar Keller, 24.04.2025
„Die Frage ‚Was ist das?‘ höre ich öfter.“

Peter Bretscher hat das Schaudepot des Historischen Museum Thurgau aufgebaut. Jetzt hat der Historiker ein 4500 Seiten starkes Lexikon zum bäuerlichen Leben unserer Region vorgelegt. (Lesedauer: ca. 4 Minuten)
Herr Bretscher, im März ist Ihr «Kind» geboren, wie Sie sagten. Nach langer Zeit ist es jetzt soweit. Wie lange haben Sie an diesem Buch gearbeitet?
Peter Bretscher: Der Start fand 2015 statt, nachdem des letzte der vier Geschosse im Schaudepot St. Katharinental in Diessenhofen, das ganz der weiblichen Arbeitswelt gewidmet ist, eingerichtet war. Die Idee zum Buch entstand 2007 anlässlich eines sachkulturellen Beitrags im Thurgauer Namenbuch. Ich bekam den Auftrag, zu 50 in Flurnamen vorkommenden Objekten einen lexikalischen Artikel zu verfassen. Daraus entwickelte sich seitens des Kantons der Wunsch, etwas Umfassenderes, Repräsentativeres zu schreiben. Gleichzeitig sollte das mit der volkskundlichen Sammlung verbundene Wissen in schriftlicher Form festgehalten werden. Da mich die Thematik bereits sehr viel früher interessierte, reichen erste Notizen schon in die Studienzeit oder noch weiter zurück.
Peter Bretscher (68) aus Winterthur, war bis 2021 Leiter des Schaudepots St. Katharinental in Diessenhofen, ein der volkskundlichen Sammlung gewidmeter Teil des Historischen Museums Thurgau. Einen ausführlichen Text zu seinem Wirken im Thurgau gibt es bei uns im Magazin. Zum Abschuss seiner Berufstätigkeit hat er ein umfassendes Werk als Open-Access-Publikation veröffentlicht, das insgesamt fünf Bände mit rund 4'500 Seiten beinhaltet. Man kann es gratis herunterladen oder einfach nur online anschauen. Die vorgestellten Objekte werden in ihrem sozialen und historischen Kontext situiert. Das im Jahr 2025 publizierte Sachlexikon und Bestimmungsbuch behandelt insgesamt rund 3‘000 Objekte, wobei ca. 2‘500 davon aus der volkskundlichen Sammlung des Historischen Museums Thurgau fotografisch abgebildet sind. Die Bände stehen kostenlos zum Download zur Verfügung und enthalten ein Namens-, Orts- und Sachregister.
Was umfasst, kurz gesagt, das fünfbändige Opus im PDF-Format von Ihnen?
Bretscher: Es geht um die ländliche materielle Kultur, im engeren Sinn um die bäuerliche Arbeitswelt und die dazu verwendeten Geräte und frühen Maschinen. Das Gesamtwerk ist in 19 Sachkapitel gegliedert, je mit einer kulturgeschichtlichen Einführung ins Thema. Anschliessend werden möglichst viele der verwendeten Geräte in Wort und Bild vorgestellt, nebst einer fotografischen Aufnahme wenn immer möglich auch mit einer historischen Bildquelle, die das Objekt im Einsatz zeigt.

«Seit der frühesten Kindheit habe ich immer etwas gesammelt, wobei sich die Inhalte stark veränderten.»
Peter Bretscher, Historiker und Kulturwissenschaftler
Sie sind ein leidenschaftlicher Sammler und konnten diese Eigenschaft auch beruflich umsetzen. Was sind die Höhepunkte in der Archivierung bzw. Sammlung?
Bretscher: Es stimmt. Seit der frühesten Kindheit habe ich immer etwas gesammelt, wobei sich die Inhalte stark veränderten. Seit ich im beruflich-musealen Umfeld Sammlungen aufzubauen hatte, 1989, hörte ich damit auf, dreidimensionale Dinge privat zu sammeln. Damals begann aber ein Interesse für historische Bildquellen, Fotos, Postkarten, wobei ein grösserer Fundus auf privater Basis entstand. Auf diesen konnte ich für das «Sachlexikon» abstützen. Im Thurgauischen Museum sind eine Anzahl Objekte Höhepunkte, die wohl in kaum einem anderen Museum der Deutschschweiz existieren. Beispielsweise eine Thurgauer Röllsteinmühle aus der Zeit ihrer Erfindung um 1790, eine Kornharfe, eine Traubentrete mit perforiertem Boden und weiteres mehr. Mit der Zeit verlagerte ich aber den Erwerb von Objekten – auch aus Platzgründen – zunehmend auf das Sammeln der mit ihnen verbundenen Geschichten. Auch diese sind in das entstandene Werk eingeflossen.
An wen richtet sich die gut 4'500 Seiten starke Open Access-Publikation mit rund 8'000 Illustrationen? Weshalb haben Sie dieses Buch geschrieben?
Bretscher: Der früher zum Fach «Volkskunde» gehörende Bereich «Arbeit und Gerät» wird heute in der Schweiz nicht mehr gelehrt. Im Gegensatz zur gut untersuchten materiellen ländlichen Kultur der alpinen Regionen fehlen solche Darstellungen für das Schweizerische Mittelland. Betreuende von entsprechenden Museumssammlungen haben Schwierigkeiten, sich die nötigen Fachkenntnisse anzueignen. Pro Woche erhalte ich bis heute etwa eine bis zwei Anfragen, oft Abbildungen eines unbekannten Objekts mit dem Hinweis «was ist das?». Die Publikation ist deshalb primär als Handbuch für Betreuende von ländlichen Sammlungen gedacht, wie sie ja in zahlreichen Museen vorkommen, aber auch für alle sonst Interessierten. Ziel des Kantons war es, eine Open-Access-Version zur Verfügung zu stellen, die frei betrachtet und heruntergeladen werden kann. Das ist nun erfüllt.
«Im Thurgauischen Museum sind eine Anzahl Objekte Höhepunkte, die wohl in kaum einem anderen Museum der Deutschschweiz existieren.»
Peter Bretscher, Historiker und Kulturwissenschaftler

Warum gibt es keine Druckversion?
Bretscher: Eine Druckversion erachtet der Kanton nicht als notwendig. Da mich einige Institutionen und Private aber darauf angesprochen haben und Interesse bekundeten, befasse ich mich trotzdem mit dem Gedanken (aber in sehr kleiner Auflage). Es liegt an mir, das zu organisieren.
2500 Gegenstände wurden vom Kreuzlinger Fotograf Meinrad Schade für das Buch fotografiert. Das Schaudepot St. Katharinental beherbergt heute rund 12'000 Gegenstände. Wie haben sich die Sammlung und das Schaudepot St. Katharinental entwickelt?
Bretscher: Der Sammlungsbestand betrug im Jahr 1981 340 Objekte und 1994, bei meinem Stellenantritt 3'300 Objekte. Den Rest konnte ich für das Thurgauische Museum im Laufe meiner 27-jährigen Amtszeit erwerben. Davon wurden geschenkt 62.5 Prozent, symbolisch entschädigt 9.3 Prozent, angekauft 27 Prozent, gefunden 0.8 Prozent, getauscht 0.35 Prozent. Das erste Ausstellungsgeschoss wurde 1997 eröffnet, das letzte Teilstück 2023 realisiert, mit einer Gesamtfläche von 2700 m2 auf vier Stockwerken.
Welches waren die Kosten für das Werk insgesamt, welches das Historische Museum Thurgau nun herausgab? Gibt es auch Sponsoren?
Bretscher: Die genauen, auf zehn Jahre verteilten Gesamtkosten kann ich Ihnen nicht beziffern. Sie setzen sich hauptsächlich zusammen aus einem Teil meines Lohns, wobei ich etwa einen Drittel in der Arbeitszeit, zirka zwei Drittel in der Freizeit geschrieben habe. Dieser Anteil hatte keine Kostenfolgen. Dazu kamen die Entlöhnungen für die Anfertigung der Fotografien, für das Lektorat und die Gestaltung. Die Jakob und Emma Windler-Stiftung in Stein am Rhein finanzierte etwa hundert Fotografien, die im Museum Lindwurm in Stein am Rhein aufgenommen wurden. Das Amt für Informatik des Kantons Thurgau hat an der Online-Stellung mitgewirkt.
Weiterlesen: Direkt zum Lexikon von Peter Bretscher.

Das Historische Museum & das Schaudepot
Das Historische Museum Thurgau verzeichnete im vergangenen Jahr 14'564 BesucherInnen. Davon waren 2'031 im Schaudepot St. Katharinental, ausschliesslich im Rahmen geführter Gruppen. Im Vorjahr waren es mit den Tagen der offenen Tür 4‘088. Heute stellt man fest, dass das Interesse der Bevölkerung an der Vergangenheit und an Geschichte allgemein gewachsen ist.
Im Unterschied zum Schloss Frauenfeld, dessen Interesse seit jeher künstlerisch oder kulturhistorisch wertvollen Gegenständen galt, werden im Schaudepot St. Katharinental Dinge gesammelt, die man unter dem Begriff «Alltagskultur» zusammenfasst. In Anlehnung an eine frühere Parole des Landesmuseums, das sich als «kulturelle Arche Noah der Schweiz» verstand, könnte die Sammlung als «kulturelle Arche Noah des ländlichen Thurgaus» bezeichnet werden. Sie ergänzt in idealer Weise die eher oberschichtlichen städtischen Bestände des Historischen Museums im Schloss Frauenfeld.
Bisher konnte das Schaudepot St. Katharinental ausschliesslich im Rahmen von Führungen besucht werden. Neu soll es zusätzlich einen Sonntag im Monat zu Spezialveranstaltungen geöffnet sein.

Von Urs Oskar Keller
Weitere Beiträge von Urs Oskar Keller
- Spaziergang mit Niklaus Meienberg (10.10.2025)
- Ein leidenschaftlicher Büchermacher (03.10.2025)
- Ein melancholischer Geschichtenerzähler (26.09.2025)
- Heidi Bucher: «Häutungen im Bellevue» (19.09.2025)
- Der kulinarische Balzac vom Bodensee (12.09.2025)
Kommt vor in diesen Ressorts
- Wissen
Kommt vor in diesen Interessen
- Interview
- Geschichte
Dazugehörende Veranstaltungen
Kulturplatz-Einträge
Ähnliche Beiträge
Der Mythos wankt
Neue archäologische Untersuchungen legen nahe: Der berühmte «Hus-Kerker» im Schloss Gottlieben stammt wohl nicht aus der Zeit von Jan Hus. mehr
Eiszeit am See
Unter dem Motto «Eisschicht statt Seesicht» präsentiert das Seemuseum Kreuzlingen noch bis April 2026 eine Wanderausstellung zur Eiszeit und erklärt, wie Gletscher eine Landschaft formen. mehr
Eine kleine Entdeckung im Toggenburg: Das Ackerhus
Vom Museumsgründer Albert Edelmann bis zum aktuellen Kinderbuch: Im Ackerhus wird Toggenburger Tradition lebendig gehalten. arttv.ch war zu Besuch. mehr