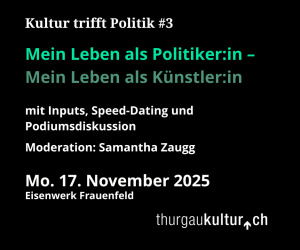von Inka Grabowsky, 02.04.2025
Alte Frage gelöst, neues Rätsel gefunden

Einmal im Jahr ziehen die Archäologen des Kantons Bilanz und berichten der Öffentlichkeit, was sie in den vergangenen zwölf Monaten herausgefunden haben. Auch dabei zeigt sich: Jede Entdeckung zieht eine Reihe von neuen Fragen nach sich. (Lesedauer: ca. 3 Minuten)
14 Grabungen, 12 Baudokumentationen, 17 Prospektionen bei Baustellenkontrollen und 94 Lieferungen: Das ist der Rechenschaftsbericht des Amts für Archäologie in mageren Zahlen. Dahinter verstecken sich Routineaufgaben, aber auch interessante neue Erkenntnisse: «Natürlich haben wir bei den üblichen Verdächtigen gegraben», sagt Kantonsarchäologe Hansjörg Brem, «aber wir sind eben auch endlich einmal im Schloss Gottlieben gewesen. Die neue Besitzerschaft hat uns Türen geöffnet, die vorher streng verschlossen waren.»
Das Rätsel des Rossweidlis
Zu den «üblichen Verdächtigen» gehören die Pfahlbausiedlungen auf dem ehemaligen Bleiche-Areal in Arbon, die längst als UNESCO-Welterbe anerkannt sind. Das heisst aber nicht, dass schon alle Fragen geklärt wären, wie Simone Benguerel erklärt. «Im Sommer vergangenen Jahres haben wir auf dem Rossweidli eine Fläche aufgegraben, die wir zuvor schon mit Kernbohrungen und Sondierschnitten untersucht hatten. Es gab unterschiedlichste Funde, vom Steinbeil aus der Jungsteinzeit bis zur neuzeitlichen Schuhsohle. Auch die Spitzen von Pfählen haben wir entdeckt – Erlenholz aus dem Jahr 3766 vor Christus. Nur erklären konnten wir die seltsame Durchmischung nicht.»
Die Autobiografie des Arboners Johann Heinrich Mayr aus dem Ende des 18. Jahrhunderts brachte die Archäologen auf die richtige Spur. Er erzählt von Starkregen und Überschwemmungen im Jahr 1795. «Wir können jetzt davon ausgehen, dass damals ein Bach mit viel Schlamm und Geschiebe in Richtung Bodensee abgeflossen ist. 6000 Jahre alte Siedlungsreste, die es bis dahin gegeben haben könnte, wurden weggeschwemmt und ab radiert. Das Wasser hinterliess stattdessen die heutige Deckschicht aus Seeablagerungen.»

Das Rätsel von Wilen bei Wil
Nach einer Entdeckung eines «Bodenschatzes» und der Grabung folgt die Auswertung. Dafür braucht es Geduld, die mitunter belohnt wird. 2018 gab es einen ersten Münzfund in Wilen bei Wil. 2023 fand man römische und keltische Münzen, 2024 entdeckten Sondengänger mit Suchbewilligung bei einer gezielten Aktion unter anderem silberne römische Denare aus den Jahren 76 vor- bis 37 nach Christus.
Noch fehlen Siedlungsreste, die erklären würden, warum der Boden in Wilen bei Wil so viel Geld enthält. «Vielleicht gab es auch nur eine heilige Eiche, zu dem man pilgerte und Geld opferte», lächelt Hansjörg Brem. «Es bleibt ein Rätsel.»
Das Rätsel der Hügeli am Bodensee-Ufer
Bei der Lösung der Frage, was die 2015 entdeckten Steinaufhäufungen im Wasser des Bodensees entlang der Uferlinie bedeuten, haben die Archäologen einen weiteren Schritt gemacht. Bisher war bekannt, dass die 170 Hügel zwischen Altnau und Romanshorn von Menschenhand gemacht wurden.
Organische Reste, die in Tiefenbohrkernen gefunden wurden, erlauben dank Radio-Carbon-Messung eine Datierung auf das 35. Jahrhundert vor Christus. «Wir haben nun 2024 vor Güttingen Steine von Hand abgetragen», erzählt Simone Benguerel. «Wir fanden zuunterst Pfähle in Seegrund und diesmal ausserdem 16 Netzsenker, also bearbeitete Steine, die Fischernetze am Boden halten.»
Dummerweise wurden Netzsenker von der Jungsteinzeit bis in die Neuzeit benutzt. «Wir sind nicht viel schlauer geworden. Möglicherweise war die Fischerei nur eine spätere Nachnutzung, weil Steinhaufen ein perfektes Fischversteck darstellen. Die ursprüngliche Funktion ist immer noch das grösste Rätsel.»

Die Mühen im Büro
Nicht immer ist die Arbeit der Archäologen und Archäologinnen aufregend. Irene Ebneter, die Leiterin der Sammlungen und der Archive, berichtet von der mühevollen Arbeit, hunderttausende Dias und Foto-Negative aus vergangenen Zeiten zu digitalisieren, um sie zu konservieren und leichter zugänglich zu machen. «Bis in die 1980er Jahre sind wir schon gekommen», seufzt sie, «und manchmal gab es auch etwas Lustiges.»
Die Arbeitskleidung der Mitarbeitenden bei Ausgrabungen im Verlauf der Jahrzehnte wäre eine eigene Recherche wert: «Zwischen Pullover und Gummistiefel und barfuss im Bikini war alles dabei», lacht sie. «Und natürlich trugen sie früher keinen Helm.»
Interesse am Museum bleibt stabil
Urs Leuzinger, der Leiter des Archäologischen Museums, kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Knapp unter 20.000 Besucher haben sich für die Ausstellungen interessiert. Besonders verweist er auf die Teilnahme «Wein am Bodensee – Fünf Museen, ein Projekt». «Wir waren die ersten, die mit ‹Bacchus und Co› ihren Beitrag umgesetzt haben.»
Unter anderem die beiden Bacchus-Statuetten seien spektakulär anzusehen. «Aber die winzigen Pollenkörner der Weinrebe vitis vinifera, die wir in Bohrkernen im Seebachtal gefunden haben, die sind viel aufregender.» So liesse sich zum ersten Mal nachweisen, dass ab dem 2. Jahrhundert nach Christus in der Region Wein angebaut wurde. Im laufenden Jahr hofft er auf noch mehr Interessenten, zumal demnächst ein Raum zu den Pfahlbau-Siedlungen in erneuerte Version zu bewundern ist. «Die Wandbilder, die zeigen, wie wir uns nach heutigem Wissen den Alltag vor 6000 Jahren vorstellen, sind schon fertig. Sie zeigen den aktuellen Stand des Irrtums.»
Ein neues Portal von «Archäologie Schweiz» erlaubt einen Einblick in die Grabungsberichte.


Von Inka Grabowsky
Weitere Beiträge von Inka Grabowsky
- Coole Kunstnacht Konstanz Kreuzlingen (10.11.2025)
- Die Demokratisierung des Kunstmuseums (07.11.2025)
- Verse zum Schmunzeln und Runzeln (03.11.2025)
- Eine Hütte mit Ausstrahlung (27.10.2025)
- Eiszeit am See (07.10.2025)
Kommt vor in diesen Ressorts
- Wissen
Kommt vor in diesen Interessen
- Bericht
- Archäologie
Kulturplatz-Einträge
Ähnliche Beiträge
Der Mythos wankt
Neue archäologische Untersuchungen legen nahe: Der berühmte «Hus-Kerker» im Schloss Gottlieben stammt wohl nicht aus der Zeit von Jan Hus. mehr
Sandegg bleibt bis 2026 gesperrt
Die Aussichtsterrasse und der Park auf der Sandegg werden von der Gemeinde Salenstein in Zusammenarbeit mit dem Amt für Archäologie Thurgau saniert. Schon jetzt erzählt der Ort spannende Geschichten. mehr
Nagellack und Muckis: Ein Sport für Powerfrauen und ganze Kerle
Augenblicke (2): Wer Sackhüpfen und Seilziehen für Belustigungen beim Kindergeburtstag hält, sollte aber beim (sportlichen) Seilziehen seine Einstellung rasch ändern. mehr