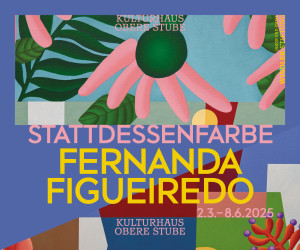von Brigitte Elsner-Heller, 13.05.2019
Frauen im Laufgitter

Begleitend zur Ausstellung „Helen Dahm – Ein Kuss der ganzen Welt“ ging es im Kunstmuseum des Kantons Thurgau um die Anfänge von Frauenförderung in der Schweiz. Sonja Scherer von der Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA referierte über eine Geschichte der Hilfe zur Selbsthilfe.
Auch ohne die Arroganz Nachgeborener darf man sich den Text vom 24. August 1928 („Der Bund, Eidgenössisches Zentralblatt und Berner Zeitung“) anlässlich der Eröffnung der ersten „Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit“ (SAFFA) einmal auf der Zunge zergehen lassen:
„Dieses ist die edelste Absicht der Saffa: In gemeinsamer Arbeit für ein gemeinsames Ziel sollen die Schweizerfrauen einander kennen und schätzen lernen. Und so kam die Ausstellung zustande: Seht, hier ringen Schwestern um ein besseres Fortkommen, stellten die einen fest, und die andern: dort wollen sie Bedürftigen und Bedrückten helfen; drüben, weitere mit Rat und materiellen Stützen eingreifen. Mit dem Drachen der Süchte und Laster kämpfen andere gar, jene Ecke mit dem zermürbenden Zustand der Verdienstlosigkeit, und jene Gruppe zieht gegen überlebte Weltanschauung zu Feld.“ (Den gesamten Artikel gibt es hier.)
Das hat schon was – und ist wohl auch deshalb noch auf der Website der heutigen Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA zu finden, die 1931 aus der ersten Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit von 1928 hervorgegangen ist und nach wie vor (meist) Frauen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit finanziell den Rücken stärkt.

Auch Kunst braucht finanzielle Mittel
Das Kunstmuseum des Kantons Thurgau in der Kartause Ittingen hat sich im Kontext seiner Retrospektive zu Leben und Werk von Helen Dahm einen Schritt weit von der „eigentlichen Kunst“ entfernt, indem es Sonja Scherer, Präsidentin der SAFFA, zu einem Vortrag eingeladen hat. Der bisher nicht erwähnte „missing link“: Helen Dahm hatte 1928 an der ersten Ausstellung in Bern teilgenommen – was ihr zu einem höheren Bekanntheitsgrad verhalf und zum Ankauf eines ihrer Bilder durch die Eidgenössische Kunstkommission.
Sonja Scherer, Referentin des Abends im Ausstellungskeller der Kartause, ist seit 12 Jahren bei SAFFA, davor war die Juristin 16 Jahre bei der UBS tätig. Bevor sie auf die Geschichte der SAFFA eingeht, ausgehend von der gleichnamigen Ausstellung 1928, stellt sie exemplarisch Erfolgsgeschichten von Frauen vor, die als Unternehmerinnen klein anfingen. Selbstredend stand SAFFA als Bürgerschaftsgenossenschaft finanziell zur Seite.

Weltanschauungen: Ein zähes Terrain
Helen Dahm taucht mit ihrem „Selbstporträt als Malerin“ kurz auf, das 1928 auf der ersten „Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit“ gezeigt wurde (und das sich heute im Besitz des Kunstmuseums Thurgau befindet). Dann auch „Weisses Stillleben“, das von der Kunstkommission angekauft wurde. Das Thema entwickelt sich jedoch weithin unabhängig von Helen Dahm bzw. der Kunst weiter, auch wenn 53 weitere Künstlerinnen bei der Ausstellung vertreten waren. Scherer verlegt sich mehr auf die politische Dimension. In Erinnerung zu rufen ist hier allerdings, dass Künstlerinnen – und auch Helen Dahm – nicht dem Schweizer Kunstverein als Aktive beitreten durften. Ein Votum, das bis 1972 Bestand hatte.
Zumindest die Zahlen sehen gut aus
Das in Zahlen ausgedrückte „Ergebnis“ der ersten Ausstellung: Über 4.000 Frauen stellten in mehr als 30 Hallen aus. 800.000 Besucherinnen und Besucher wurden gezählt und 11 Millionen Franken Umsatz gemacht bei einem Gewinn von 600.000 Franken. Ein nicht unerheblicher Nebeneffekt: Es wurden 250.000 Stimmen für das Frauenstimmrecht eingeholt. Man erinnert sich: vergebens. Dieses Ziel wurde bekanntlich erst 1971 erreicht.
Nach einer längeren Diskussionsphase, wie der Gewinn der Ausstellung nachhaltig zu verwenden sei, entschied man sich zur Gründung der Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA (Gründungsjahr: 1931). „Man wollte Frauen mit der Finanzwelt in Verbindung bringen“, formuliert die ehemalige Bankerin Sonja Scherer. SAFFA vergibt dabei bis heute keine Kredite, sondern übernimmt die Bürgschaften gegenüber Banken. Hilfe zur Selbsthilfe lautet die Devise.
Rückschlag in den konservativen 1950er Jahren
Eine zweite „Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit“ fand 1958 in Zürich statt, ebenfalls mit einigem finanziellen Erfolg. Dennoch ist die Stimmung anders, das Frauenbild ist wieder konservativer geworden. „Die Frauen waren bemüht, keine Angriffsfläche zu bieten“, sagt Sonja Scherer. Das Weltbild sieht für Frauen zwar Bildung vor, jedoch keine Berufstätigkeit, wenn eine Frau Mutter ist. Noch während die zweite SAFFA in Zürich läuft, tritt eine radikale Feministin auf den Plan: Iris von Roten veröffentlicht ihr kritisches Buch „Frauen im Laufgitter“. „Der Skandal war perfekt“, resümiert Sonja Scherer. Forderungen nach voller wirtschaftlicher Unabhängigkeit für Frauen, Stimmrecht, Mutterschaftsversicherung, Krippen, Horten und Tagesschulen, aber auch nach freier weiblicher Sexualität – das war in den rigiden Nachkriegsjahren schlicht zuviel. Wenig später lehnten zwei Drittel der alleinig wahlberechtigten Männer das Frauenwahlrecht erneut ab.
Was die Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA heute angeht: Etwa 90 Bürgschaften laufen augenblicklich, und seit 2007 gibt die Eidgenossenschaft Finanzhilfen, indem sie sich an Betriebskosten beteiligt und 65 Prozent der Verluste trägt. Und es werden zwar immer noch überwiegend, aber nicht mehr ausschliesslich Frauen gefördert. Eine Frage aus dem Publikum lässt Sonja Scherer zwar mit ihrer Antwort zögern, aber dann doch nicht kneifen: Ob Frauen bei den Banken weniger leicht Kredite erhielten als Männer? Frauen nähmen sich eher zurück, seien sich ihrer eigenen Fähigkeiten nicht so bewusst, verlangten bis heute weniger für sich, antwortet sie etwas indirekt. Eine Erfahrung, die sich auch in der Antragstellung bei SAFFA ausmachen lasse.
Helen Dahm: «Wir kamen nicht zu Wort.»
Möge Helen Dahm zum Schluss doch noch einmal das Wort erteilt werden. Im Katalogbeitrag zur laufenden Ausstellung „Ein Kuss der ganzen Welt“ ist dem Jahr 1928 ein Zitat zugeordnet: „Als Frau werde ich nicht angenommen, auch mein Werk nicht. Das gehört auch zu meinem Schicksal. Es gibt eine Gesellschaft der Maler. Ich bin in dem Verein gewesen mit anderen Frauen zusammen. Wir kamen nicht zu Wort und konnten auch nichts bestimmen. Man hat uns dort weder als Kamerad noch als Kollege angenommen. Das habe ich nicht ausgehalten, und ich bin ausgetreten.“


Weitere Beiträge von Brigitte Elsner-Heller
- Mit einer gewissen Bestürzung (31.10.2022)
- Liebe und Hass: Die Welt der Ambivalenzen (14.09.2022)
- Offene Rechnungen (15.08.2022)
- «Wir mögen gut erzählte Geschichten.» (02.08.2022)
- Sex in Zeiten des Krieges (18.07.2022)
Kommt vor in diesen Ressorts
- Wissen
Kommt vor in diesen Interessen
- Bericht
- Bildende Kunst
Ähnliche Beiträge
Alte Frage gelöst, neues Rätsel gefunden
Einmal im Jahr ziehen die Archäologen des Kantons Bilanz und berichten der Öffentlichkeit, was sie in den vergangenen zwölf Monaten herausgefunden haben. mehr
Lektionen in Mut
Der St. Galler Künstler Hans Thomann hat eine Bronzeskulptur in Erinnerung an den NS-Widerstandskämpfer Georg Elser gestaltet. Damit wird jetzt die deutsche Journalistin Dunja Hayali ausgezeichnet. mehr
Was wird aus dem Stadtlabor?
Die Raiffeisenbank Frauenfeld stellt seit 2021 ihre Liegenschaft für das „StadtLabor" zur Verfügung. Die Nutzungszahlen sind gut. Doch zum Jahresende soll Schluss sein mit der Zwischennutzung. mehr