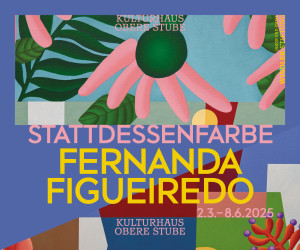von Bettina Schnerr, 01.07.2019
Ein guter Zuhörer

Seine Figur Tabor Süden ist nach mehr als 20 Fällen praktisch Kult, seine Krimis heimsen ebenso regelmässig Preise ein wie seine Drehbücher: Die Rede ist von Friedrich Ani. Der bayrische Schriftsteller sprach am Freitag in Gottlieben über seinen aktuellen Roman und dessen ganz besondere Personenkonstellation.
Das Exemplar, aus dem Friedrich Ani lesen wird, ist sichtlich neu: Gerade eben erst erschien sein Kriminalroman „All die unbewohnten Zimmer“ und das Publikum im Bodmanhaus gehört zu den ersten, denen der Autor einen Einblick in dessen Entstehung gewährt. Das Gespräch führt Moderatorin Esther Schneider, die die Redaktion der Literatursendung „52 beste Bücher“ des SRF leitet. Ihre Ankündigung verspricht viel: „Ich behaupte, dass es ein Fest für alle Leser wird.“
Das Besondere an diesem Roman sind seine Hauptdarsteller. Friedrich Ani lässt erstmals drei seiner Ermittlerfiguren gemeinsam auftreten. Mit dabei sind Tabor Süden, der stille Spezialist für Vermisste; Jakob Franck, Kommissar im Ruhestand und immer noch für die Überbringung von Todesnachrichten zuständig, weil es sonst keiner gerne tut; Polonius Fischer, ein Kriminalkommissar mit mehrjähriger Vergangenheit als Benediktinermönch. Süden, der Dienstälteste, ermittelt in inzwischen 21 Fällen seit 1998. Polonius Fischer tauchte ein paar Mal zwischen 2006 und 2009 auf, während Franck eine recht neue Figur mit zwei literarischen Einsätzen ist.

Figuren, die ihm ans Herz gewachsen sind
Genau das macht Esther Schneider neugierig: Wie kam die Idee einer gemeinsamen Ermittlung zustande? Die existierte tatsächlich schon länger, verrät der bayrische Autor. Die ihm so gut bekannten Figuren zusammen zu bringen, war für Ani eine interessante Herausforderung. Sie verlief zunächst im Sand, weil seine Buchreihen über mehrere Verlage verteilt waren und die Verlage „nicht so begeistert“ gewesen seien. Nach dem Wechsel zu seinem jetzigen Verlag Suhrkamp entwickelte Ani die Figur des Jakob Franck und brachte die Idee nochmals bei seinem Lektor ins Gespräch: „Mei, wenn d‘meinst ...“.
„Ich sass also am Konzept und habe schnell gemerkt, das wird schwierig, da stimmt was nicht,“ erinnert sich Ani. „Ich habe gebastelt und war schon kurz vor dem Aufgeben, als ich es endlich gemerkt habe: Es fehlt jemand.“ Ihm wurde bewusst, es müsse eine vierte Figur von aussen dazukommen, um die Konstruktion abzurunden. Nach einer Weile stand für ihn fest, dass er eine Frau als Gegenpol benötigt und daraus entwickelte sich Fariza Nasri, eine Beamtin mit syrischen Wurzeln. Was aber von Beginn an feststand: „Ich wollte sie nie so wie im Western losschicken, vier Ermittler, die nebeneinander Richtung Tatort reiten.“
Video: Friedrich Ani liest aus „All die unbewohnten Zimmer“
Die Frau mit der zweiten Chance
Die „neue“ Nasri ist denn auch jene Figur, mit der Ani den Roman eröffnet. Eine „Meisterin der Übersprunghandlung“, meint ihr Schöpfer, der für sie eine Biografie mit brutalem Mobbing innerhalb der Polizei entwickelt hat. Nach Jahren in der Provinz holt Polonius Fischer sie zurück ins Münchner Kommissariat, insgeheim wissend oder zumindest ahnend, dass ihre Strafversetzung mit äusserst unfairen Mitteln herbeigeführt worden war.
Friedrich Ani formt seinen Roman aus zwei Fällen, an denen die vier Ermittlerfiguren in unterschiedlichen Rollen beteiligt sind. Nur langsam führt er sie zusammen und es kann schon einmal sein, dass Fariza Nasri an Tabor Süden vorbeiläuft, ohne es zu merken. Man wird sich erst später kennenlernen müssen, wenn Ani seine Fäden immer dichter spinnt und klar wird, dass sich einige davon überschneiden.
Nicht sentimental, aber empathisch
Friedrich Anis Figuren sind vielfach einsame Seelen, die sich zwischen Resignation und, hier vereinzelt, Hass eingerichtet haben. Vor den Ermittlern macht er damit keineswegs Halt. Vom Leben erschöpft empfindet er sie aber nicht. Viel eher setze ihnen im Alter das zu und das, was sie erlebt haben: „Schaut man auf die Ratlosigkeit der Hinterbliebenen, fragt man sich als Ermittler schon, was man bewirkt hat.“ Mit dem Lösen eines Falls ist deren Leid noch lange nicht zu Ende. „Ermittler reflektieren ihre Arbeit. Das geschieht auch in der Realität so,“ erzählt Ani. „In Büchern klingt das immer spektakulär, aber bei so einer Arbeit braucht man tatsächlich Zeit und Rituale, um wieder runterzukommen.“
Genau das, lobt Esther Schneider, sei eine Qualität der Romane: „Man kommt den Menschen sehr nahe und erlebt die Atmosphäre sehr intensiv.“ Dass seine so menschlichen Geschichten im Krimi-Genre spielen, habe sich so ergeben: „Dieses Genre habe ich recht spät für mich entdeckt. Doch ich habe schnell gemerkt, dass es das optimale Medium für meine Themen und Charaktere ist,“ erinnert sich Ani.
Und so einsam, traurig und „verschattet“ die Figuren auch sind, sie können Überraschungen in sich bergen. Einer von ihnen beweist schlussendlich ein bemerkenswertes Mass an Zivilcourage. Eine andere erwacht aus einer auferlegten Ruhe und rächt ein Unrecht.
Video: Nie ohne Selbstironie: „Ich fand die Achtziger schon in den Achtzigern scheisse!“
Die Vernehmung als Kunstform
Friedrich Ani nimmt sich viel Zeit für Polizeiverhöre und schafft den verhörten Menschen damit viel Raum, sich zu erklären. „Das ist nicht nur ein sehr wichtiges Element bei den Ermittlungen,“ sagt Ani. „Die Vernehmung ist als Gespräch eine Kunstform und das schätze ich literarisch.“ Man müsse sich beispielsweise viel Gedanken um Fragetechnik machen, oder darum, wie Menschen sprechen oder handeln, die tatsächlich lügen oder nicht alles erzählen wollen. „Das stumme Verschnaufen vor der Konstruktion einer Lüge,“ wie er es im Roman formuliert, sei so ein interessantes Phänomen. Der nächste Roman, verriet er an diesem Abend, werde sich genau deswegen sehr stark um Vernehmungen drehen.
„Ich selbst höre eher zu als dass ich rede,“ gibt Ani zu. „Schweigt man, fangen die Leute einfach an zu erzählen.“ In ihm stecke mehr Tabor Süden als Franck oder Fischer. Und Ani muss ein guter Zuhörer sein: „Bei meinen Recherchen schreibe ich fast nie mit. Das Gehörte bleibt hängen, treibt mich um, und beim Schreiben darüber erlebe ich ein Echo des Gehörten.“

Auf ein Glaserl mit dem Autor
Die übliche Fragerunde gegen Ende verlegten Marianne Sax, Programmgestalterin des Bodmanhauses, und Esther Schneider kurzerhand in den Garten. Wer trotz sommerlicher Temperaturen seinen Weg nach Gottlieben genommen hatte, wurde im Anschluss mit einem auskunftsfreudigen Friedrich Ani belohnt.
Im Garten drehten sich die Gespräche durchaus nochmal um seine Figuren voller Brüche in ihren Biografien. Sind sie nur literarisch wertvoller auszuloten? Das auch, sagt Ani, anders wäre es schon langweiliger. „Ich erlebe allerdings weitaus mehr Menschen so, mit ihrem Scheitern und ihren Ecken, als rundum zufriedene und ausgeglichene Menschen. Meine Figurenwelt in den Büchern ist durchaus ein Bild dessen, wie ich die Menschen erlebe.“
Video: Friedrich Ani stellt seinen ersten Roman mit Ex-Kommissar Jakob Franck im Gespräch mit Wolfgang Herles vor

Weitere Beiträge von Bettina Schnerr
- Dreckiges Erbe (20.02.2023)
- Wie hart trifft die Energiekrise die Kulturbranche? (28.11.2022)
- Plötzlich Hauptfigur (14.11.2022)
- Hinter den Kulissen von Licht- und Farbenzauber (09.09.2022)
- Jägerin des verborgenen Schatzes (04.07.2022)
Kommt vor in diesen Ressorts
- Literatur
Kommt vor in diesen Interessen
- Kritik
- Belletristik
Ähnliche Beiträge
Am Anfang war das Haus
Das Kleine als Chance: Das Literaturhaus Thurgau in Gottlieben ist 25 geworden und setzt auf Literatur als persönliche Begegnung. Am 26. April wird das gross gefeiert. mehr
Neuer Verein macht sich stark für Lesevergnügen
„Lesestadt Aadorf“ möchte Lesekompetenzen fördern sowie Gross und Klein für das Kulturgut Buch begeistern. Ein Vorhaben, dem eine Kabelnetzgenossenschaft aus Aadorf ordentlich Startkapital zuspeist. mehr
Was wir von Ameisen lernen können
Die Autorin Tabea Steiner stellt am Samstag mit ihren Kolleg:innen des HOT Kollektivs ein neues Buch im Kunstraum Kreuzlingen vor. Zur Einstimmung – ein Text über das Zusammenhalten. mehr