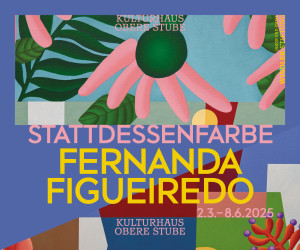von Brigitta Hochuli, 21.02.2012
Heimspiel mit Höpli

Gottlieb F. Höpli, bis 2009 Chefredaktor des Tagblatts, ist nach Steckborn zum Talk im Turmhof geladen. Für den musisch Begabten ist der Thurgau kultureller Nährboden.
Interview: Brigitta Hochuli
Herr Höpli, Sie haben in Ulrico Hoepli aus Ihrem Heimatort Wängi einen berühmten Namensvetter, der 1870 nach Mailand auswanderte und es dort als Buchhändler und Verleger zu Ruhm und Wohlstand brachte. Seine 1911 gegründete Stiftung unterstützt bis heute viele Kulturprojekte auch im Thurgau. Welches sind Ihre Berührungspunkte?
Gottlieb F. Höpli: Die Mailänder Hoeplis in dritter und vierter Generation und meine Familie sind miteinander bekannt, einige von ihnen sogar befreundet. Den gegenwärtigen Seniorchef Ulrico Carlo treffen wir zwei- bis dreimal jährlich – in Tuttwil oder Wängi, wo es im Ortsarchiv eine Hoepli-Abteilung hat, oder im Tessin. Ulrico dokumentiert mich dann immer mit neuesten Ausgaben aus seinem Verlag.
Wie der Mailänder Verleger haben auch Sie als studierter Germanist eine Affinität zu Büchern. Auf thurgaukultur.ch wurde frühzeitig und lebhaft die Buchpreisbindung diskutiert. Zwei Thurgauerinnen kämpfen an vorderster Front dafür und dagegen. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Gottlieb F. Höpli: Ich bin gespalten. Als einer, dessen Arbeit ohne eine hochentwickelte Kulturtechnik des Lesens nicht denkbar ist, bin ich für jede vernünftige Massnahme – auch staatliche – zu haben, welche dem Buch und seiner Verbreitung hilft. Das gehört zum Bildungsauftrag des Staates. Als Liberaler bin ich andererseits für möglichst wenig Staatseingriffe in den Markt. Strukturerhaltung um der Strukturerhaltung willen ist nicht mein Ding.
Mit Peter Rüedi war kürzlich ein weiterer bekannter Thurgauer im Bodman-Literaturhaus in Gottlieben zu Gast, er las aus seiner Dürrenmatt-Biographie. Rüedi hat den gleichen Jahrgang 1943 wie Sie und besuchte mit Ihnen die Kantonsschule Frauenfeld. Haben Sie spezielle kulturelle Erinnerungen an diese Zeit?
Gottlieb F. Höpli: Unsere Kantizeit, zu der auch die Studentenverbindung Thurgovia gehört, war eine anregende und angeregte. Das gab es tatsächlich schon vor 1968. Wir haben in der Thurgovia mehr zeitgenössische Literatur behandelt als im Unterricht. Und es gab auch Performance-Aktionen, zum Beispiel eine Installation aus Reinigungsmaterial des Abwarts im "Fremdenzimmer", oder eine Fahrt mit einem Topolino auf der Aschenbahn. Alles vom Rektorat nicht so gern gesehene kulturelle Aktivitäten. Peter Rüedi war damals schon ein grosser Jazzfan. Mit meinem Musiklehrer, dem unvergessenen Paul Danuser, fuhren wir schon auch mal an ein Konzert von Quincy Jones in Kreuzlingen.
Sie und Peter Rüedi sind zwei Beispiele für kulturell interessierte Intellektuelle, die unter vielen dem Thurgau den Rücken gekehrt haben. Das wird zuweilen heftig bedauert. Sehen Sie Gründe dafür?
Gottlieb F. Höpli: Dass man für seine Lehr- und Wanderjahre den Thurgau verlässt, ist ja wohl verständlich. Bei mir waren es Berlin und die Uni Zürich – und da bin ich dann eben auch hängengeblieben. Das Problem dieses "brain drain" ist also die oft fehlende Möglichkeit, das Gelernte in der Heimat auch anzuwenden. Dafür gibt es für die Söhne und Töchter des Thurgaus einfach zu wenig attraktive Arbeits- und Karrieremöglichkeiten. Andererseits sind doch Metropolen wie Zürich auf eine intellektuelle Zuwanderung angewiesen. Was wäre Zürich, wenn man es nur den Zürchern überliesse? Mich schaudert.
Nach Berlin und Zürich kamen Sie 1994 nach St. Gallen. Wie haben Sie als Chefredaktor des Tagblatts mit seinem damaligen Kopfblatt in Arbon den kulturellen Thurgau wahrgenommen und was haben Sie zu seiner Resonanz in Ihrem Medium beigetragen?
Gottlieb F. Höpli: Der Thurgau ist ein kulturell lebendiger, vielgestaltiger Kanton, dem es aber an einem kulturellen Zentrum fehlt, auf das man bequem seinen Fokus einstellen könnte. Diese dezentrale Kultur ist von einem Medium schwieriger einzufangen. Weil in einem zentralen Kulturteil zentrale Kulturproduktionen in der Stadt St.Gallen an erster Stelle stehen und regionale Produktionen aus dem ganzen Einzugsgebiet bald einmal keinen Platz mehr haben. Der Thurgau war aber neben der Stadt St.Gallen der einzige Regionalteil, der eine regionale Kulturseite bekam.
Und wie nehmen Sie den kulturellen Thurgau heute als Privatmann wahr?
Gottlieb F. Höpli: Das kantonale Kulturschaffen erscheint mir stärker strukturiert, professionalisiert und damit auch profilierter als früher. Das ist kein Holzboden, sondern ein Nährboden der Kultur.
Was wächst vor Ihren Augen auf diesem Nährboden konkret?
Gottlieb F. Höpli: In meiner Heimat- und Geburtsgemeinde Wängi sind auch heute Leute wie Ruedi Götz oder Andreas Raas daran, das kulturelle Erbe aufzuarbeiten und zu pflegen. Eben ist ein sehr schönes Heft über das Naturschutzgebiet Grütried auf Wängener Gemeindegebiet erschienen, das 2011 sein 75-Jahr-Jubiläum feierte. Ein geschütztes Riedgebiet für Vögel und Pflanzen, das war damals eine Pioniertat.
Als Publizist und Präsident des Vereins Medienkritik Schweiz sind Sie immer noch à jour. Wie kann man Kultur einem Mediennutzer am besten schmackhaft machen?
Gottlieb F. Höpli: Dafür braucht es nicht nur kompetente und kreative Kulturschaffende, sondern auch kompetente und kreative Journalisten, welche Kulturvermittlung so attraktiv betreiben, dass in ihrer Zeitung möglichst schon auf der Frontseite dafür Platz eingeräumt wird - und nicht nur dem Fussball. Zudem braucht es Blattchefs und Blattmacher, die selber kulturell interessiert sind. Das haben wir beim St.Galler Tagblatt immer wieder geschafft. Kultur war und ist in dieser modernen Zeitung nicht mehr auf ein einziges Gefäss beschränkt, was zwar Gefahren birgt, aber auch Chancen.
Sprechen wir von den Gefahren und Chancen einer Öffnung der Kultur. Die Kulturstiftung des Kantons Thurgau hat eine Jahr lang öffentliche Kultur-Debatten veranstaltet. Die Kulturschaffenden und Kulturveranstalter blieben weitgehend unter sich. Haben Sie ein Rezept, wie solche Bemühungen besser unters Volk zu bringen wären?
Gottlieb F. Höpli: Ich weiss nicht, ob jene, die ausgeblieben sind, zuvor überhaupt gefragt wurden, worüber sie gerne debattieren würden. Gerade auch kulturferne Kreise! Wenn nicht, muss man sich nicht wundern, dass es bei Insider-Veranstaltungen bleibt.
Seit Ihrer Pensionierung spielen Sie in Ihrem heutigen Wohnort Teufen die Orgel. Erzählen Sie uns von Ihrer musikalischen Erziehung im Thurgau?!
Gottlieb F. Höpli: Der Frauenfelder Musikdirektor Paul Danuser war für mich fast eine Vaterfigur. Er förderte mich am Klavier, an der Orgel, und mit meiner Mama sangen wir im Oratoriengesangverein OGV, den er dirigierte. Familiär belastet war ich schon: Mein Grossvater mütterlicherseits und mein Onkel waren im Thurgau Lehrer und Organisten und inspirierten das dörfliche Musikleben in bewundernswert vielfältiger Weise.
Herr Höpli, Sie haben eine sechsjährige Tochter. Erziehen Sie sie bewusst zu einem kulturell interessierten Menschen oder überlassen Sie das dem Zufall?
Gottlieb F. Höpli: In einem kulturell interessierten Elternhaus wird der Boden gelegt. Klein Sophie sitzt gerne auf dem Sofa mit einem Bilder-Buch, geht in die St.Galler Singschule, die von meiner Frau präsidiert wird, und geht ins Ballett. Und sie liebt Bach mehr als lauten Pop.
Und ausserhalb des Elternhauses? Wie führt man da die jungen Menschen am besten so früh wie möglich an die Kultur heran? Im Thurgau wurde neulich das Museum für Kinder lanciert - wie finden Sie das?
Gottlieb F. Höpli: Als erstes müsste die musische, vor allem die musikalische Erziehung in der Schule aufgewertet werden. Das Museum für Kinder kenne ich nicht. Aus Erfahrung weiss ich aber, dass sich Kinder für fast alles interessieren, wofür sich die Eltern interessieren. Sei es ein Museum, sei es klassische Musik, sei es Papa an der Orgel.
In einem Gespräch haben Sie einmal bedauert, dass Ihr Interesse an der Thurgauer Kultur grösser sei als jenes der Thurgauer und der Thurgauer Kultur an Ihnen. Jetzt kommen Sie zu einem „Heimspiel“ nach Steckborn. Was versprechen Sie sich davon?
Gottlieb F. Höpli: Die Veranstalter des "Heimspiels" muss ich natürlich von meiner Kritik ausnehmen. Ich kenne sie schon seit Jahrzehnten. Und kann ihnen nur gratulieren zu dieser Begegnungsreihe.
*****
„Heimspiel“ am Samstag, 25. Februar, 17.30 Uhr, im Turmhof Steckborn.
*****
Gottlieb F. Höpli
Gottlieb F. Höpli (gfh.), Jahrgang 1943, wuchs im hinterthurgauischen Wängi auf einem Bauernhof auf. Schon vor der Griechisch-Matur an der Kantonsschule Frauenfeld hospitierte er auf der Redaktion der Thurgauer Zeitung und schrieb Reportagen und Musikkritiken. Dem Ziel, Journalist zu werden, dienten auch seine Studien der Germanistik, Publizistik und Soziologie an den Universitäten Zürich und FU Berlin, die er mit einer Arbeit über den Berliner Theaterkritiker Alfred Kerr abschloss.
Nach der Tätigkeit als freier Journalist für schweizerische und deutsche Medien trat Höpli 1978 in die Inlandredaktion der NZZ ein. 1994 bis 2009 war er Chefredaktor des St.Galler Tagblatts. Heute schreibt er noch Glossen und Kolumnen fürs Tagblatt und die NZZ am Sonntag und amtiert als Präsident des Vereins Medienkritik Schweiz (www.medienkritik-schweiz.ch). Gottlieb F. Höpli war schon immer fasziniert von der Musik Johann Sebastian Bachs und ist heute häufig an den Orgeln im heimischen Teufen (AR) oder in der Stadt St.Gallen anzutreffen. Er ist verheiratet; die jüngste seiner drei Töchter ist sechs Jahre alt. (pd)
***
Heimspiel - Kopfspiel
Die „Heimspiele“ der Stiftung Turmhof Steckborn werden seit 2008 durchgeführt. Dabei sei trotz des Namens Steckborn nicht das Einladungskriterium für die Talk-Runden, sagt Alex Bänninger, der die Gespräche führt. Die Gäste müssten aber Thurgauerinnen oder Thurgauer sein oder einen Teil ihres Lebens hier verbracht und ausserhalb des Kantons etwas erreicht haben. „Sie kommen für einen Weile wieder heim und lassen sich auf ein Kopfspiel ein.“ Darum der nicht sehr originelle Titel, der sich aber eingeprägt habe. Es gebe einen treuen Publikumsstamm zwischen jeweils 20 bis 60 Personen. Eingeladen würden die Gäste aber nicht wegen einer allfälligen Quote. Stiftungsrat Robert Fürer wähle aus, wen er subjektiv für interessant halte. „Alle Gäste waren wunderbar, spannend, einmalig, brillant“, findet Bänninger. (ho)

Weitere Beiträge von Brigitta Hochuli
- Kultur für Familien: Was im Thurgau noch fehlt (06.09.2018)
- Rätsel gelöst: So alt ist der Kunstraum Kreuzlingen (29.06.2018)
- Musikschule Kreuzlingen sucht Verbündete (14.06.2018)
- Kult-X in WM-Stimmung: Das etwas andere Public Viewing (29.05.2018)
- Unterm Sternenhimmel (13.05.2018)
Kommt vor in diesen Ressorts
- Kulturpolitik
Kommt vor in diesen Interessen
- Interview
- Medien
Ähnliche Beiträge
Kulturjournalismus in Nöten: Ein Diskussionsbeitrag
Die Medien löschen der Kultur die Lichter. Sie wird für die Öffentlichkeit ausgeblendet. Das kulturaffine Publikum, das Orientierung sucht, tappt zunehmend im Dunkeln. mehr
Die Qual der Wahl
Wie wir arbeiten (7): Wer entscheidet über die Themen und Texte im Magazin von thurgaukultur.ch? Redaktionsleiter Michael Lünstroth gibt Einblicke. mehr
„Der Thurgauer ist kein Meister der Streitkultur!“
Diskretion als Erfolgsrezept: Hans Jörg Höhener, Präsident der kantonalen Kulturkommission, erklärt im Interview, wie sein Gremium Einfluss nimmt auf die Kulturpolitik im Kanton. mehr