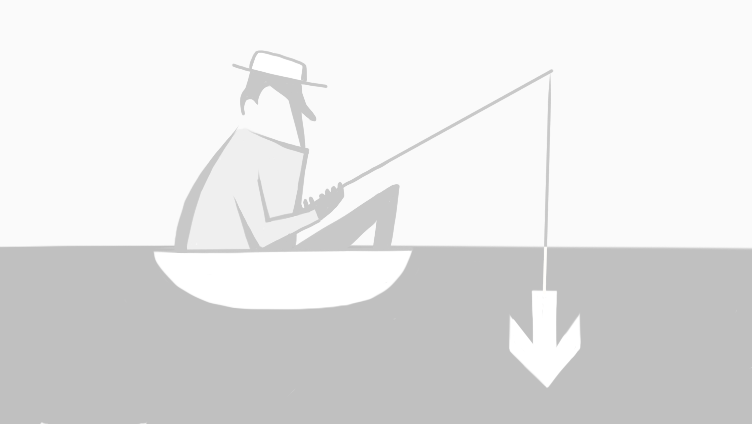von Markus Schär, 02.04.2020
Weshalb das Virus den Thurgau am wenigsten trifft

Die Ansteckungsrate ist im nationalen Vergleich unter den Thurgauerinnen und Thurgauern am geringsten. Das lässt sich nicht nur mit Glück erklären, sondern auch mit einer tausend Jahre alten Kultur.
«Als Passagier auf der guten alten Titanic wäre der Thurgauer schnöde ertrunken», witzelte Pascal Hollenstein. Denn die Mostinder hätten sich auch auf dem untergehenden Luxusdampfer an die Vorschriften gehalten, wie die Briten, die viele Opfer beklagten, weil sie vor den Rettungsbooten Schlange standen, statt wie die Amerikaner zu drängeln. Der publizistische Leiter von CH Media, der aus dem Tannzapfenland stammt, schloss mit der Glosse in seinen Blättern einen Tweet-Wechsel mit mir ab. Wie kam es dazu?
Der frivole Austausch fing mit einer seriösen Feststellung an. Der Politikforscher Michael Hermann zeigte, dass sich das Coronavirus im lateinischen Raum viel schneller verbreitete als im deutschsprachigen. Und ich schickte seine Grafik auf Twitter weiter, weil ich schon zuvor auf der Karte mit den kantonalen Daten erfreut gesehen hatte, dass der Thurgau am wenigsten Ansteckungen pro Kopf aufwies.
Räumliches Distanzhalten ist mitunter kulturell bedingt.
«Das Coronavirus hat auch eine Kulturgeographie», erkannte Michael Hermann. Er erklärte die höhere Zahl von Kranken im Tessin und in der Romandie mit dem alltäglichen Umgang: «Räumliches Distanzhalten ist mitunter kulturell bedingt.» Daraus zog Pascal Hollenstein den logischen Schluss: «Der Thurgauer als solcher ist die zwischenmenschlich unterkühlteste Subspezies des Homo sapiens helveticus – gewissermassen auch im Sozialen ein saurer Most.»
Das, meine ich, müssen wir Mostinder uns nicht gefallen lassen. Denn die vergleichsweise günstige Lage kommt von Qualitäten, die eine Würdigung verdienen. Dass der Thurgau im Kampf gegen das Virus bis heute am besten dasteht, mag Glück sein. Dass er zu den Besten gehört, aber nicht: Auf der Schweizer Karte zeigt sich – gleich wie bei der Arbeitslosigkeit, bei den Gesundheitskosten oder sogar bei der Lebenszufriedenheit – ein tausend Jahre alter kultureller Unterschied.

Klar: Wo viele Menschen zusammenleben, steckt man sich eher an
Gewiss, wer auf die Karte schaut, der findet auf den ersten Blick eine simple Erklärung: Zürich hat die doppelte Ansteckungsrate des Thurgaus, in Basel ist sie siebenmal, in der Waadt und in Genf achtmal so hoch. Vielleicht zeigt sich da also, wie bei vielen Abstimmungen, einfach der Gegensatz zwischen Stadt und Land. Wo viele Menschen zusammen arbeiten, wohnen, essen und feiern, stecken sie sich selbstverständlich leichter an. Das galt schon, als im 14. Jahrhundert in ganz Europa die Pest wütete.
«Ein Virus hat die Schweiz lahmgelegt. Die Städte sind wie leergefegt, die Züge fahren nicht mehr richtig, Grenzzäune werden aufgestellt. Ausnahmezustand überall, Lockdown», schrieb denn auch Katja Fischer De Santi in einem schönen Text im Tagblatt. Der Lockdown gelte aber nicht ganz überall: «In meinem Dorf gibt es nicht viel, was runtergefahren werden könnte. Es gibt hier nur drei Läden: Bäckerei, Metzgerei und Volg, und in keinem halten sich durchschnittlich mehr als drei Personen auf.» Wer die Städter sehe, die sich heroisch im #stayathome üben, der könne auf dem Land nur milde lächeln: «Plötzlich wird eine Lebensweise, die bis vor einer Woche als weltabgewandt galt, instagramable.» Müsste man also den verschreckten Städtern empfehlen, ihr trautes Heim im Thurgau oder im Toggenburg zu suchen?

Aber: Der Gegensatz zwischen Stadt und Land erklärt nicht alles
Der zweite Blick auf die Karte zeigt, dass die wohlfeile Erklärung mit dem Gegensatz zwischen Stadt und Land zu kurz gedacht ist. Der Kanton Zürich hat nur ein Drittel der Ansteckungen der weit weniger urbanen Waadt, die Mittelland-Agglo Aargau nur ein Viertel der Alpen-Idylle Wallis. Und der abgeschiedene Jura (Hauptort: Delémont, 12‘682 Einwohner) hat viermal so viele Krankheitsfälle wie der von Zehntausenden Pendlern kolonisierte Thurgau (Hauptstadt: Frauenfeld, 25’297 Einwohner). Allein an der Urbanität können die auffälligen Unterschiede also nicht liegen.
Eine treffendere Erklärung finden wir meiner Meinung nach zwar durchaus, wenn wir die Besiedlung anschauen – aber nicht jene von heute, sondern jene vor mehr als einem Jahrtausend. Ab dem 7. Jahrhundert zogen die Alemannen in die heutige Ostschweiz, und sie rangen der Wildnis ihre Höfe und Weiler ab, jeder auf sich allein gestellt. Davon zeugen heute noch die Ortsnamen, die auf -ikon (von -inchova = der Hof des…) enden. Zahlreich finden sie sich zwischen Weinfelden und Wil: Diese sanfte Hügellandschaft, die Jacques Herzog und Pierre de Meuron in ihrem «städtebaulichen Porträt» der Schweiz von 2005 als eine der seltenen «stillen Zonen» würdigten, weist 2020 immer noch dieselbe Siedlungsstruktur auf wie im 9. Jahrhundert.
Von der «Mentalität der römischen Bürokratie»
Die Burgunder dagegen zogen in der Völkerwanderung in die heutige Westschweiz. Dort stiessen sie noch auf belebte Städte, vor allem Aventicum (Avenches), passten sich der eingesessenen kelto-romanischen Bevölkerung an und fügten sich in die weiterhin bestehende Ordnung ein. So überlebte in diesem germanischen Stamm die «Mentalität der römischen Bürokratie», wie der Journalist Markus Somm meint: «Geld ausgeben, auch wenn man es nicht mehr hatte, gehörte zu den Markenzeichen der imperialen Herrschaftskultur.»
Die kulturellen Unterschiede zwischen den Alemannen und den Burgundern, zu denen auch die Berner gehören, prägen die Schweiz bis heute. Der Volkskundler Richard Weiss, dessen Werke die Lektüre immer noch lohnen, zeigte es 1947 mit der faszinierenden Studie «Die Brünig-Napf-Linie als Kulturgrenze zwischen Ost- und Westschweiz auf volkskundlichen Karten». Die Unterschiede sah er da beispielsweise bei den Fasnachtsbräuchen oder bei den Freitagsspeisen, beim Mosttrinken oder beim Zuggeschirr für das Rindvieh und vor allem beim Jassen: mit französischen Karten im Westen, mit deutschen im Osten – der Thurgau, wo einige Gebiete die französischen vorziehen, ist eine Ausnahme. (Dies wohl wegen der vielen Berner Einwanderer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.)

Die Burgunder erwarten mehr vom Staat
Und es geht nicht nur um Brauchtum aus der guten alten Zeit. So fanden Ökonomen, dass die Romands länger in der Arbeitslosigkeit bleiben und weniger Unternehmen gründen als die Deutschschweizer. Dasselbe Bild zeigt sich bei der Sozialhilfe, bei den Invalidisierungen und vor allem bei den Gesundheitskosten, beziehungsweise den Volksabstimmungen dazu: Die Burgunder erwarten mehr vom Staat – und sie möchten mit nationalen statt kantonalen Lösungen die Alemannen dafür bezahlen lassen.
Ja, der Unterschied lässt sich sogar bei der Lebenszufriedenheit nachweisen. Hoch bis sehr hoch war sie gemäss Haushalt-Panel bei 79 Prozent in der Zentralschweiz und bei 76 Prozent in der Ostschweiz, doch nur bei 67 Prozent in der Genferseeregion. Völlig unzufrieden mit seinem Leben zeigte sich jeder zwanzigste Alemanne, aber jeder zehnte Burgunder.
Der Schlüssel: Ein Mix aus Eigenverantwortung und Gemeinsinn
Dasselbe Bild sehen wir jetzt im Kampf gegen das Virus: Die Burgunder fordern Staatseingriffe (an die sie sich aber weniger strikt halten als die Deutschschweizer), die Alemannen glauben an Eigenverantwortung. Wie die Ansteckungsraten in den Kantonen beweisen, erzielen sie damit bessere Ergebnisse. Michael Hermann, der für SRF repräsentative Umfragen zur Lage macht, warnt deshalb davor, die Massnahmen, die für das Tessin und die Romandie geboten sein mögen, zentralistisch auch der Deutschschweiz aufzuzwingen.
«Eigenverantwortung für die Gesundheit und Gemeinsinn beim Schutz der Schwächeren» heisst das Motto, mit dem die Schweiz den Kampf gewinnt. (Übrigens: Eigenverantwortung + Gemeinsinn = Genossenschaft.) Dabei stehen die Thurgauer, siehe Statistik, an vorderster Front. Eigentlich schade, dass sie untergehen, wenn sie sich auf der Titanic nicht vordrängeln.

Von Markus Schär

Weitere Beiträge von Markus Schär
- Für Gotteslohn in der Textilfabrik (08.01.2020)
- Wie Peter Stamm sein Weinfelden sieht (07.11.2019)
- «Historiker sind keine Richter» (23.09.2019)
- Bohren nach dem Rätsel (11.06.2019)
- Thurgauer mit langen Fingern (16.05.2019)
Kommt vor in diesen Ressorts
- Wissen
Kommt vor in diesen Interessen
- Analyse
- Gesundheit
Ist Teil dieser Dossiers
Ähnliche Beiträge
Die Kraft der Kräuter
Wie entstanden die Heilkräutergärten der Klöster und wo spielen sie noch heute eine Rolle? Damit beschäftigt sich der erste Teil unserer neuen Serie «Facetten des Mittelalters». mehr
Was man 2023 in der Kartause Ittingen erleben kann
Zeitgenössische Kunst, historische Ausstellungen, spirituelle Seminare und die traditionellen Pfingstkonzerte: Die Kartause Ittingen hat ihr Programm für 2023 vorgestellt. mehr
Ein Ende mit Schrecken!
Das Messingobjekt misst 4 Zentimeter in Höhe, Breite und Tiefe und war lange Zeit ein effektiver Helfer von Chirurgen und Badern – aber wobei? mehr